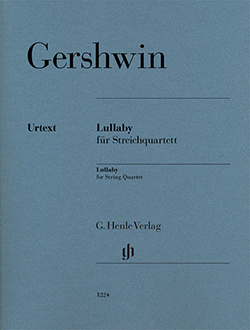George Gershwin
Lullaby für Streichquartett
hg. von Norbert Gertsch, Urtext, Stimmen/Studienpartitur
Von George Gershwin gibt es ein einziges Werk für Streichquartett: Lullaby. Wahrscheinlich hat er es als Aufgabe von seinem Kompositionslehrer Edward Kilenyi erhalten und es hat ihm so gut gefallen, dass er es später in einer Broadway-Revue einsetzte.
Die Quellenlage ist durchwachsen, wie Herausgeber Norbert Gertsch in seinem aufschlussreichen Vorwort schreibt. Es gibt nämlich kein Autograf, weder der Stimmen noch der Partitur. Als Autograf ist nur die Fassung für Klavier vorhanden, und die umfasst nur 27 der insgesamt 162 Takte, nämlich das Wiegenlied. Eine Ausgabe des Streichquartetts gibt es seit 1968, nachdem 1967 das kurze Werk vom Juilliard String Quartet uraufgeführt worden war. Zuvor gab es die Aufführung einer Bearbeitung für Akkordeon durch den Harmonika-Virtuosen Larry Adler. Die damals veröffentlichte Streichquartett-Ausgabe ist noch immer bei Alfred Publishing Co. erhältlich.
Der Henle-Verlag legt nun eine wissenschaftlich erarbeitete Urtextausgabe vor, die sich im Wesentlichen auf den Stimmsatz stützt, der von einem unbekannten Autor abgeschrieben wurde. Die autografe Partitur ging offenbar verloren. Die autografe Klavierfassung ist undatiert und kann möglicherweise auch nach dem Streichquartett entstanden sein.
Das etwa achtminütige Werk ist für Streichquartette ein dankbares Stück, gleichsam ein früher Cross-over-Beitrag, angesiedelt zwischen Jazz, Salon und Klassik. Der erste Geiger wird mit Flageolettspiel und Oktav- und Terzgriffen gefordert. Das gesamte Ensemble muss sich in die synkopenreiche, „swingende“ Rhythmik von Gershwin einleben. Insbesondere der Cellist – er vertritt den Bassisten aus dem Jazz – hat hier eine wichtige Rolle. Die stimmungsvolle Melodie wird zu einem ruhigen, ein wenig sentimentalen „Song“ für Streichquartett verarbeitet. So kann dieses Lullaby als schöner Ausklang eines Streichquartettkonzerts höchst wirkungsvoll eingesetzt werden.
Die Ausgabe des Henle-Verlags schafft die Voraussetzung für eine eigenständige Interpretation. Das Notenbild der Stimmen ist klar und übersichtlich. Die Partitur ermöglicht einen guten Überblick über den musikalischen Satz. Fingersätze, Angaben zur Dynamik und Artikulation wurden vom Stimmsatz der Abschrift übernommen. Das gibt den Interpreten den direkten Zugang zum Werk, unverfälscht durch „interpretierende“ Herausgeber.
Allerdings ist „Urtext“ hier in diesem konkreten Fall doch auch wiederum höchst fragwürdig: Wenn kein Autograf vorhanden ist und man sich nur auf die Abschrift eines Unbekannten stützen kann, ist es genau und konsequent betrachtet nicht möglich, von einem „Urtext“ zu sprechen. Bei aller Wertschätzung der Henle’schen
Urtextausgaben: Hier hat sich der Markennamen verselbstständigt, worunter dann eine differenzierte Betrachtung leidet. Aber sei’s drum: Nützlich und hilfreich für die Praxis ist diese neue Ausgabe allemal.
Franzpeter Messmer