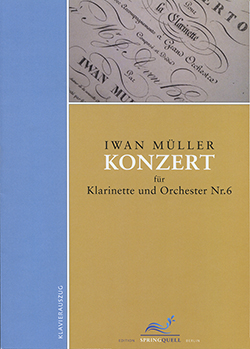Iwan Müller
Konzert
für Klarinette und Orchester Nr. 6, Klavierauszug
Die Entwicklung der Klarinette wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts maßgeblich durch den in Reval (Tallinn) geborenen Iwan Müller (1786-1854) vorangetrieben. Er war als durch Europa reisender komponierender Klarinetten-Virtuose zugleich als sein eigener Botschafter unterwegs, um die Klarinettenwelt von seinen bahnbrechenden Erfindungen zu überzeugen. Sein Ziel war, Klarinettisten durch Verbesserungen und Anbringung weiterer Klappen am Instrument in die Lage zu versetzen, alle Tonarten gut klingend spielen zu können, um damit den Wechsel zwischen den verschieden gestimmten Instrumenten überflüssig zu machen.
Müllers Projekt der „clarinette omnitonique“ mit jetzt 13 Klappen hatte zwar beim Pariser Konservatorium zunächst keine Anerkennung gefunden, sich aber dann doch durchgesetzt. Darüber hinaus machte er sich Gedanken über die Verbesserung der Klappenpolster und auch die Blattschraube geht auf seine Erfindung zurück.
Als Komponist hat er auf beliebten Opernarien basierende Air varié und Fantasien geschrieben, die in den Variationenfolgen Gelegenheit zur Demonstration der Virtuosität bieten. Diesem Zweck dienen auch die sieben Solokonzerte Iwan Müllers, von denen das erste im Neudruck 2012 in der Edition Ebenos (siehe das Orchester 4/2013, S. 68) erschienen ist, und das 6. Konzert jetzt von der Klarinettistin Friederike Roth herausgegeben wurde, die sich als Interpretin mit zwei CD-Einspielungen u.a. mit diesem Konzert (Dabringhaus und Grimm MDG 901 1846-6) besonders intensiv mit dem Werk Iwan Müllers beschäftigt hat.
Das 1824 veröffentlichte Konzert entspricht formal der gängigen Dreisätzigkeit mit fließenden Satzübergängen und steht in g-Moll. So hebt die Orchesterexposition mit dramatischem Gestus an, der sich ab dem Einsatz der Solo-Exposition mit einem ruhigeren melodischen Verlauf und dann einsetzenden verschiedenartigen Spielfiguren aber wieder verliert und erst im Schlusstutti wieder hereinbricht. Im Mittelsatz demonstriert Müller die Fähigkeiten seines Instruments in A-Dur unter häufiger Verwendung der mittleren Lage, während er sich im Schlusssatz der beliebten Polacca mit einem Bolero-Einschlag bedient, um über dem markanten Rhythmusmodell bei begrenztem harmonischem Geschehen der Virtuosität freien Lauf zu lassen.
Stilistisch zeigt das Konzert bei der Behandlung der Solopartie noch nicht in die Richtung des romantischen Ausdrucks. Die Nutzung des tiefen Registers als klangsinnliche Ausdrucksmöglichkeit wie sie Carl Maria von Weber ein Jahrzehnt zuvor gezeigt hat, ist bei Iwan Müller nicht zu finden. Der Orchesterpart hat neben den Tutti-Einwürfen wenig Anteil am motivischen Geschehen und beschränkt sich weitgehend auf die Rolle der harmonischen Unterstützung des Solisten.
Die Herausgabe des Konzerts mit einem nach den Stimmen des Erstdrucks von Jean-Christophe Charron erstellten gut spielbaren Klavierauszug mit Instrumentationsangaben ergänzt das Studienmaterial an Konzertliteratur aus dem frühen 19. Jahrhundert.
Heribert Haas