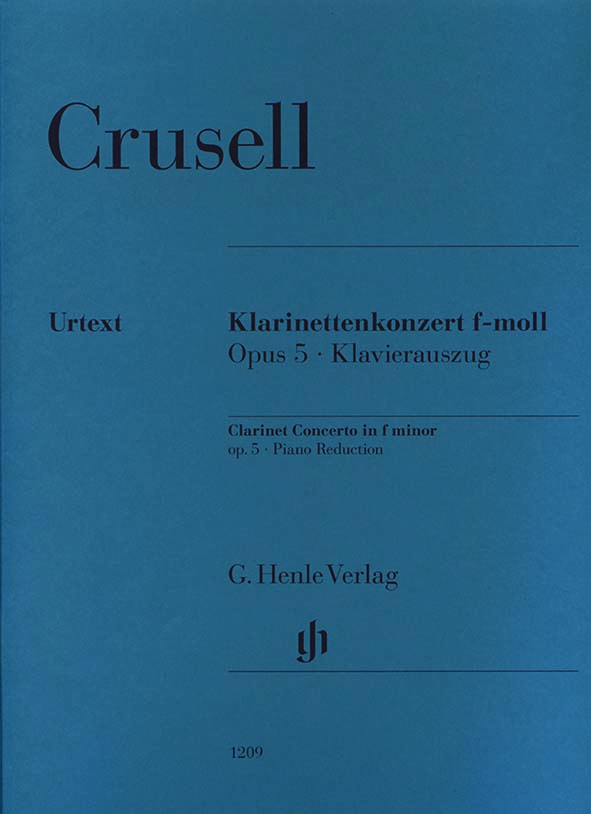Crusell, Bernhard Henrik
Klarinettenkonzert f-Moll
opus 5, hg. von Nicolai Pfeffer, Klavierauszug von Johannes Umbreit
Die Gattungsgeschichte des klassischen Klarinettenkonzerts ist reichhaltiger, als es die überstrapazierte Allgegenwart von Mozarts Klarinettenkonzert KV 622 vermuten lässt. Neben einigen für die Klarinette schreibenden Komponisten wie z. B. Franz Krommer gibt es eine Vielzahl von Klarinettisten, die sich ihre eigenen Konzerte auf den Leib geschrieben haben. Aber nicht alle erreichen dabei eine überzeugende gestalterische Qualität über den Solopart hinaus. Diese gelingt jedoch dem schwedischen Klarinettisten Bernhard Henrik Crusell (1775-1838) in seinen drei Konzerten und einer Reihe von Kammermusikwerken.
Crusells Musik steht stilistisch Beethoven nahe. In seinem als Grand Concerto bezeichneten, hier vorliegenden zweiten Konzert, das vermutlich 1815 entstanden ist, nutzt er die motivisch-thematische Arbeit, um das Orchester zu einem gewichtigen Partner des Solisten zu machen. Diesen lässt Crusell zwar virtuos brillieren, aber er hält ihn so im Zaum, dass die musikalische Aussage nicht zu kurz kommt. Besondere Beachtung finden das Chalumeau-Register und die dynamischen Besonderheiten der Klarinette, die im langsamen Satz mit Echo-Stellen ausgekostet werden.
Jost Michaels (1922-2004) hatte das Konzert anfangs der 1960er Jahre wiederentdeckt und bei Sikorski veröffentlicht. Jetzt legt der Henle-Verlag das Konzert als Urtext vor, herausgegeben von dem Klarinettisten Nicolai Pfeffer. Nicht immer ist die Quellenlage so einfach und übersichtlich wie bei Crusells Opus 5: Als einzige Quelle kann nur die Erstausgabe verwendet werden, da weder die originale Partitur noch die Stimmenabschriften erhalten sind. Die Erstausgabe in Stimmen ist 1817 bei Peters in Leipzig erschienen. Der Klavierauszug wurde auf diesem Material basierend von Johannes Umbreit erstellt.
Eingriffe des Herausgebers waren nur erforderlich, wo der Notentext durch Fehler oder Ungenauigkeiten des Notenstechers nicht eindeutig ist. Es werden verschiedentlich fehlende Artikulationszeichen und unklare Crescendo- oder Akzentklammern angemerkt. Dabei verfährt der Herausgeber nicht immer ganz konsequent, wenn er einmal die Artikulation als Herausgeberzusatz kennzeichnet und ergänzt, im übernächsten Takt aber darauf verzichtet (siehe 3. Satz T. 228 und 230; ähnlich 1. Satz T. 131, dessen Oktavierung Rückschlüsse auf die fehlende Artikulation in T. 130 zulässt). Auffällig ist, dass in der Erstausgabe im letzten Satz die Ungenauigkeiten zunehmen. Es fehlt häufiger die sonst sehr genau beachtete Artikulation, und plötzlich treten neben Staccato-Punkten auch Keile auf. Vielleicht hat Crusell wegen der schnellen Abreise des Briefträgers mit der Verlagspost die Stimmen nicht mehr ganz genau bezeichnen können oder es waren verschiedene Notenstecher am Werk
…
Diese kleinen editorischen Probleme beeinträchtigen aber weder die Qualität des Werks noch die der Urtext-Ausgabe.
Heribert Haase