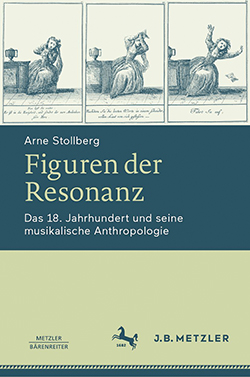Arne Stollberg
Figuren der Resonanz
Das 18. Jahrhundert und seine musikalische Anthropologie
Wer bei Musik an den Konzertsaal denkt, bei Medizin hingegen an den OP-Saal, mag die beiden Bereiche in weiter Entfernung voneinander verorten. Von ihrer Verbindung zeugt indes eine Reihe gebräuchlicher Redewendungen, die Arne Stollberg zusammenträgt: „Dass man nach wie vor davon spricht, zartbesaitet oder in schlechter Stimmung zu sein, gespannte Nerven zu haben, an einer Magenverstimmung zu leiden, die aber langsam abklinge – all dies zeigt, wie sehr die Vorstellung des Leibes als Musikinstrument unser Denken über den Menschen immer noch prägt.“ Die besagte Vorstellung des Leibes als Musikinstrument wurzelt in der Annahme des Nervensystems als Geflecht aus vibrierenden Saiten. Äußere Reize führen demnach zu einem inneren Mitschwingen, wie sich auch die innere Verfassung körperlich ausdrückt.
Stollbergs Argumentation zufolge resultiert diese Vorstellung aus der Musik des 18. Jahrhunderts, in der sich aus der statischen Abbildung von Affekten deren dynamischer Mitvollzug entwickelt, sodass die Musik letztlich nicht abstraktes Symbol, sondern konkreter Träger körperlich-seelischer Zustände ist. Der Entfaltung dieses Zusammenhangs kommt es zugute, dass Kapitel mit anthropologischer, medizingeschichtlicher, kunsttheoretischer und werkanalytischer Ausrichtung einander abwechseln, ohne dass die Grenze zwischen den einzelnen Fachdiskursen verwischt.
Geschickt wandert der Fokus allmählich von der Wissenschafts- zur Kunstgeschichte. Musikalische Analysen sind kurz und bündig gehalten, womit ihnen in erster Linie die Funktion von Illustrationen derjenigen Textquellen zukommt, die die Argumentation leiten. Eine besondere Stärke der Darstellung besteht in der verbalen Abschattierung von Bewegungs-, Affekt- und Empfindungsnuancen, sodass man geradezu eine Art nachträglicher Kompensation der im 18. Jahrhundert diagnostizierten Begrenztheit der Sprache bei der Erfassung von Gestik und Mimik vermuten möchte.
Die Monografie beruht auf umfangreichen Vorarbeiten ihres Autors und stützt sich auf eine Vielzahl von Quellen. Es mag skeptisch stimmen, dass die zitierten Vertreter der Medizin meist auf die Musik verweisen, die genaue Beschaffenheit, Qualität und Intensität der ästhetischen Verwicklung also außer Acht lassen, während umgekehrt der Nachweis eines „medizinisch informierten Komponierens“ auf Notentexten beruht, da eine verbale Reflexion seitens der Musikschaffenden rar gesät ist. Doch selbst wenn die direkten Verbindungslinien im Fall der Musik nur wenige Spuren hinterlassen haben, bleibt der reiche Widerhall des medizinisch-anthropologischen Wissensstandes der Zeit in der Kunst insgesamt verblüffend und Stollbergs Forschung dazu bemerkenswert.
Sören Sönksen