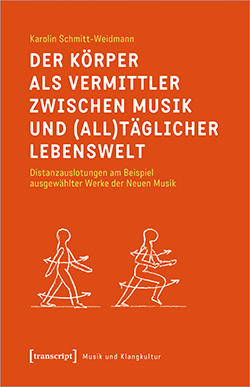Karolin Schmitt-Weidmann
Der Körper als Vermittler zwischen Musik und (all)täglicher Lebenswelt
Distanzauslotungen am Beispiel ausgewählter Werke der Neuen Musik
Ein gutes Beispiel für verschiedene Funktionen eines körperlichen Phänomens in Konzerten: Husten kann für sich als physischer Reiz stehen, gezielt als Störfaktor eingesetzt werden oder sogar als Notation das klangliche Mittel einer Komposition sein. Karolin Schmitt-Weidmann widmete sich in ihrer Dissertation einem für die Musik dringlichen Thema: In der bildenden Kunst, im Theater und literarischen Formaten hatte man Performanz schon seit einigen Jahrzehnten als Forschungsgegenstand entdeckt. Dabei ist die Körperlichkeit der Ausführenden als bewusster Teil des Aufführungsprozesses auch in der nicht-dramatischen Musik einer Betrachtung, die theoretische Voraussetzungen, praktische Beispiele sowie Ansätze einer Rezeption einbezieht, durchaus wert. Wandernde Klänge durch physische Räume setzen die Mobilität der Mitwirkenden voraus. Konzept-Komponierende wie Johannes Kreidler erarbeiten Materialien für Instrumente und weisen Musizierenden nicht-musikalische Aufgaben zu. Performanz-Anweisungen gibt es seit Karlheinz Stockhausen und in Sonderfällen bereits früher.
Schmitt-Weidmann beginnt mit einer Darstellung verschiedener Theorien über die Schwelle zwischen „Alltagswelt“ und Kunsterlebnis. Sie hebt im Folgenden die Wirkungsfaktoren „Erkenntnis“, „Überraschung“ und „Ritual“ hervor und erwähnt Ausnahmesituationen an Schnittstellen zwischen offenen bzw. geschlossenen Werkkonzepten. Im Anhang veröffentlicht sie ihre von 2016 bis 2019 entstandenen Interviews mit Dieter Schnebel, Robin Hoffmann, Annesley Black, Vinko Globokar, Heinz Holliger, Hans-Joachim Hespos und Cathy van Eck. In diesen wird beschrieben, wie Körperreaktionen und Körperaktionen Teil des Kompositions-, Gestaltungs- und Aufführungsprozesses werden. Es geht um coole und empathische Wirkungsakzente.
Schmitt-Weidmann untersucht Definitionen von vorsätzlichen, aber auch willkürlichen Artikulationen und Bewegungen. Dadurch entstehen Darstellungen von Werkaspekten mit anderen Effizienzen, als dies konventionelle Methoden der Partitur-Analyse und historischer Klassifizierungen bewirken. Neue Facetten treten in den Vordergrund durch Intertextualität und mediale Aspekte, wenn Laien und Improvisationen variable Bestandteile von Aufführungen und Werkinhalten sind. Körperlichkeit wird in der Musik zu einer wesentlichen Schwellenerfahrung als Sonderform zeitgemäßer Manifestationen des Kulturbetriebs. Die Wittener Tage für neue Kammermusik und Ultraschall Berlin sind nur zwei Beispiele für Festivals, bei denen sich Performanz und Körperlichkeit mit fast jedem Programmpunkt ändern und dabei für das Werkerlebnis spezifische Bedeutung haben.
Roland Dippel