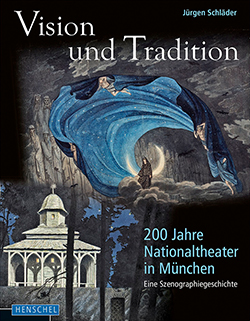Jürgen Schläder
Vision und Tradition
200 Jahre Nationaltheater München: Eine Szenographiegeschichte
Am Beginn des 19. Jahrhunderts war das nach Plänen von Karl von Fischer erbaute und nach dem Brand 1823 durch Leo von Klenze um die Säulenvorhalle erweiterte Königliche Hof- & Nationaltheater zu groß für die Isar-Metropole. Mit der Uraufführung von Ferdinand Fränzls Oper Die Weihe begann am 12. Oktober 1818 die Geschichte eines der bedeutendsten Opernhäuser. Die Entwicklung auch zur Idee der Festspiele zeichnet Jürgen Schläder anlässlich des Jubiläums „200 Jahre Nationaltheater in München“ anhand von Bühnenbildskizzen, Gemälden und Dokumenten nach. Diese erlauben Rückschlüsse auf Abweichungen von Intentionen der Komponisten und Textdichter, folgend dem Zeitgeschmack, Ideen der Ausstatter und politischen Implikationen.
Nach einem Abriss über die Vorgeschichte, Betriebsformen und Stückauswahl seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stellt Schläder die Entwicklung am Beispiel von sieben Inszenierungen mit Ausblick auf Rezeption und Repertoire-Präsenz dar. Er beginnt mit der Zauberflöte (1818), die bis Ende des 19. Jahrhunderts ohne große Veränderungen auf dem Spielplan stand. Im Vergleich der Ausstattung mit der Schinkels in Berlin beschreibt Schläder Simon Quaglios dämonisierende Bildsprache beim Auftritt der Königin der Nacht und weiter, dass Quaglios „klassisches“ Ägypten nur in Ansätzen dem Textbuch Emanuel Schikaneders folgt.
Anhand der sechs Ölgemälde, auf denen Martin Echter Momente von Richard Wagners eigener Regie der Uraufführung seiner Meistersinger von Nürnberg festhält, erläutert Schläder Akzentuierungen durch den Maler und Betrachter. Echter machte die Liebesbeziehung zum thematischen Mittelpunkt des Zyklus, etwa wenn er bei „Beckmessers nächtlichem Ständchen“ die in dieser Szene aktiven Figuren Beckmesser und Sachs nach hinten platzierte und das Paar Walter und Eva in den Fokus rückt.
Schläder analysiert die Bühnenbilder zur Münchner Erstaufführung von Strauss’ Frau ohne Schatten kurz nach der Wiener Uraufführung. Er vergleicht die beiden Aida-Ausstattungen von Helmut Jürgens 1948 in der Ausweichspielstätte Prinzregententheater und zur Wiedereröffnungswoche des wiederaufgebauten Nationaltheaters 1963. Ein Zufall ist, dass sich mit der Ausstattung von Georg Baselitz von Parsifal 2018 der Band mit einem Comeback der Bühnenmalerei enden kann.
An diesen Beispielen wird deutlich, dass Bühnenbildner wie die Familie Quaglio, Heinrich Döll, Helmut Jürgens und Jürgen Rose oft über lange Zeiträume hinweg in München tätig waren. Sie prägten die Ästhetik des Nationaltheaters und trugen zur Realisierung des Anspruchs bei, hochkarätige Aufführungen von musterhafter Qualität zu gestalten. Die Bühnenpraxis bei den Großen Opern, besonders gepflegt nach 1830, wird in die Betrachtung einbezogen und in ästhetische Zusammenhänge gestellt, ebenso die Beeinflussung der Bildsprachen durch den politischen Kurs.
Roland Dippe