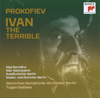Prokofjew, Sergej
Iwan der Schreckliche
Oratorium für Alt, Bass, Knabenchor, Chor und ORchester op. 116, Olga Borodina, Ildar Abdrazakov, Rundfunkchor Berlin, Staats- und Domchor Berlin, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Ltg. Tugan Sokhiev
Stalin tobte. Persönlich hatte er den Auftrag für die Erstellung eines Propagandastreifens über Iwan den Schrecklichen gegeben. Denn in ihm sah er einen vorbildlichen Staatsmann, der das rücksichtslose Vorgehen gegen das eigene Volk als notwendige Reaktion auf Intrigen legitimierte. Das sollte Blaupause und Freibrief für Stalins eigenes brutales innenpolitisches Handeln sein. Und nun das: Statt einer Glorifizierung sah man in der zweiten Folge des Historienepos eine von Machtgier und Zweifeln
geplagte Führerpersönlichkeit (Maria Biesold). Das war Verrat.
Verantwortlich für die Fehlinterpretation durch Unwissenheit in Bezug auf historische Fakten, wie es am 4. September 1946 in der Verlautbarung des ZK der KPdSU hieß, waren der gefeierte Regisseur Sergej Eisenstein (Panzerkreuzer Potemkin) und der Komponist Sergej Prokofjew. Sie hatten nach dem preisgekrönten ersten Part über die Thronbesteigung Iwans im zweiten Teil die Tragödie eines Böses schaffenden Zaren entworfen. Der Film kam erst 1958, fünf Jahre nach Stalins Tod, in die russischen Kinos. Anfang der 1960er Jahre stellte der Dirigent Abram Stassewitsch mit einzelnen musikalischen Nummern ein Oratorium zusammen.
Tugan Sokhiev, der junge russische Shooting-Star am Dirigentenpult des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin, hatte das Werk im Januar 2013 zusammen mit dem Rundfunkchor sowie dem Staats- und Domchor Berlin, der Mezzosopranistin Olga Borodina und dem Bass Ildar Abdrazakov aufgeführt. Nun liegt dieser wertvolle Beitrag zur Repertoire-Erweiterung der Prokofjew-Einspielungen auf CD vor.
Von Beginn an offenbart sich die ganze Bandbreite der pluralistischen Ausdruckskraft Prokofjews. Die filmischen Notwendigkeiten vergrößerten noch einmal das ohnehin breite Spektrum. Traditionelle Melodien (Ozean-Meer) und liturgische Gesänge wechseln mit vorantreibenden Rhythmen und tonalitätssprengenden Elementen ab. Mal klingts nach Peter und der Wolf beim Marsch des jungen Iwan, dann wieder nach amerikanischer Filmmusik à la John Williams im Orchesterstück Ich werde Zar. Visionen von Tod und Gewalt (Auf den Knochen der Feinde) werden abgelöst von lyrischen Passagen wie im Gesang Der Schwan. Das Wiegenlied Vom Biber offenbart schon in der unheilverkündenden Intonation der Streicher geheimste Machtlust, die bei Olga Borodina durchaus mehr Intensität haben könnte. Mit ätzender Schärfe stürzt sich dagegen das Orchester in den Tanz der Opritschniki, bevor der Chor im Finale die Rückkehr des Zaren herbeifleht. Hier ist nichts Zufälliges, nichts Flüchtiges. Von Tugan Sokhiev, dem Deutschen Symphonie-Orchester und den Chören wird alles mit Klarheit und Exaktheit dargestellt.
Dankenswerterweise war bei dem Konzertmitschnitt auf die sehr pathetisch-überhöhenden Erzählertexte verzichtet worden, die Stassewitsch eingefügt hatte. Leider wurden ebenso die von dem Schriftsteller Wladimir Kaminer für die Aufführung in Berlin erstellten Passagen weggelassen. So spricht die Musik allein für sich. In all ihrer Pluralität markiert sie den ersten wichtigen Schritt Prokofjews in Richtung des großangelegten Gipfelwerkes, der Oper Krieg und Frieden.
Christoph Ludewig