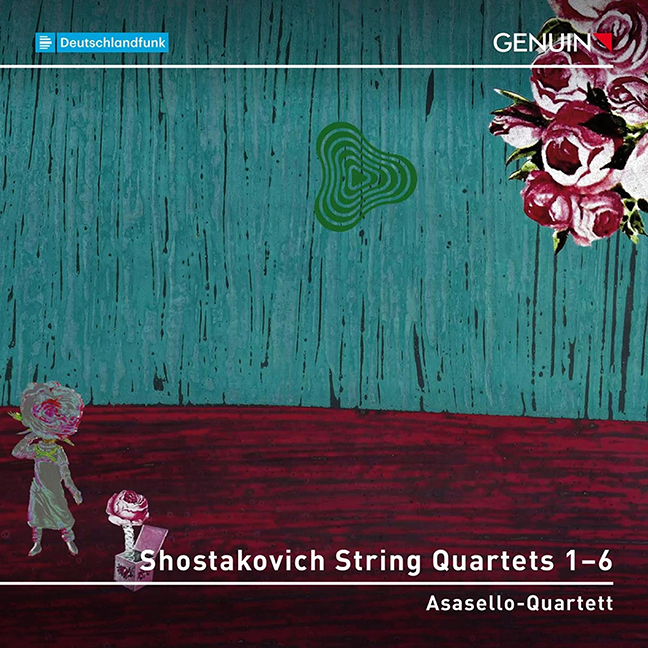Dmitri Schostakowitsch
String Quartets 1–6
Asasello-Quartett
Bereits in den Jahren 2022 bis 2024 spielte das Asasello-Quartett sämtliche 15 Streichquartette aus der Feder Dmitri Schostakowitschs ein. Das Ensemble selbst ist international besetzt mit dem russischen Primgeiger Rostislaw Koschewnikow, der Schweizerin Barbara Streil, der Bratscherin Justyna Sliwa aus Polen und dem Finnen Teemu Myöhänen am Violoncello.
In den vorliegenden CDs sind die ersten sechs Quartette sowie zwei kleine Stücke von 1931 des russisch-sowjetischen Komponisten vereinigt, und zwar interessanterweise in absteigender Chronologie, ausgehend von Nr. 6 G-Dur op. 101 aus dem Jahre 1956. Schostakowitsch hatte inzwischen bereits eine Vielzahl seiner berühmten Werke komponiert und veröffentlicht, die Schrecken der Stalinzeit lagen drei Jahre hinter ihm. Der Hörer taucht also aus dem Zwielicht des sogenannten „politischen Tauwetters“ in das Dunkel der brutalen und mörderischen Sowjetzeit der 1930er-Jahre hinab. Die beiden Geiger, die den Text des Booklets verfasst haben, möchten die „Energie freisetzen, die trotz des Vakuums der ‚gnadenlosen Epoche der Finsternis‘ entstanden ist“. Diese würde „uns in unseren Dunkelheiten erreichen, weil sich Dunkelheiten dann doch nicht so weit unterscheiden“. Eine nicht ganz unproblematische Aussage, da man sich kaum mehr den Leidensdruck, den Schostakowitsch in der Schreckensherrschaft Stalins erlitt, aus heutiger Perspektive vorstellen kann.
Aber warum sollte sich der interessierte Hörer für das Asasello-Quartett entscheiden? Was unterscheidet ihre von anderen Aufnahmen, gerade mit Blick beispielsweise auf das Quatuor Danel, das erst vor etwa einem Jahr sich ebenfalls mit einer Neuaufnahme aller Streichquartette präsentierte – die seitdem als moderne Referenzaufnahme gilt. Blicken wir exemplarisch auf das reifste Werk, die Sechste, aus dem Jahre 1956: Als Erstes fallen die raschen Tempi auf, für die sich das Vierer-Ensemble entschied. In etwa 20 und einer halben Minute sind sie mit Schwung schon durch, während sich das Quatuor Danel beinahe 24 Minuten Zeit nimmt, insbesondere das Lento dauert 90 Sekunden länger. Das Borodin-Quartett nahm sich 1966 gar 4 Minuten länger Zeit als das Asasello-Quartett, das zwar mit Genauigkeit, akkurater Technik, Homogenität und hoher Deutlichkeit in der Stimmführung überzeugt. Das Borodin-Quartett dagegen überrascht durch feinen, ziselierten Strich, Liebe zum Detail und einer erschütternde Schmerzensruhe, die den Hörer magisch in seinen Bann zieht. Trotz des Willens des jungen Ensembles, besagte Energie aus Dunkelheit freizusetzen, spricht aber neben der Tragik, der beißenden und untergründigen Ironie Schostakowitschs und seinem „sardonischen Lächeln“ insbesondere der tiefe Schmerz in seinem Werk eine tragende Rolle, der eben in den vorliegenden Interpretationen nicht so ganz heraussticht und an der Oberfläche verharrt.
Werner Bodendorff