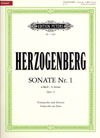Herzogenberg, Heinrich von
Sonate Nr. 1 a-Moll op. 52
für Violoncello und Klavier
Du hast, wie mir scheint, noch nichts geschrieben, was so kunstvoll, männlich und gesund einher schreitet, schrieb Bach-Biograf Philipp Spitta an seinen Freund Heinrich von Herzogenberg, nachdem dieser ihm im Sommer 1886 ein Exemplar der druckfrischen Cellosonate op. 52 zugesandt hatte. In ihren gemeinsamen Leipziger Jahren 1872 bis 1885 hatte Herzogenberg häufig das Urteil Spittas gesucht, bevor er neue Werke in den Druck gab. Aus seiner Berufung als Kompositionsprofessor nach Berlin im Jahr 1885 zog Herzogenberg neues künstlerisches Selbstbewusstsein: Er legte Spitta das fertige Werk vor. Einem anderen Bekannten gegenüber beschrieb er seine Cellosonate mit den Worten furioso sempre, ma con passione und nannte sie einen wahren Waldteufel und kein Professorenstück, wie Ihr wohl erwartet. Johannes Brahms indes, der Hochverehrte, zu dessen Freundeskreis Herzogenberg zählte, äußerte sich ablehnend über die Introduktion des 3. Satzes, was Herzogenberg zu den bitteren Sätzen veranlasste: Für Sie ist doch alles, was unsereiner schreibt, wirklich ehrlicher Schmarrn; da kommts mir auf diese paar Takte [
] nicht an, wenn Sie nur im übrigen freundlich und menschlich zu uns sind.
Dies und vieles mehr ist nachzulesen im von Bernd Wiechert verfassten Vorwort zur vorliegende Ausgabe, die von der Internationalen Herzogenberg-Gesellschaft in Auftrag gegeben wurde. Und sogleich schlägt das Rezensenten-Herz höher: Bevor das Cello gestimmt und der Klavierdeckel hochgeklappt ist, können interessierte Musiker aus der Notenausgabe Informationen zu Person und Werk erhalten und sich zudem dank Revisionsbericht einen Überblick über die Quellenlage verschaffen. Diese wirft übrigens kaum Probleme auf: Da kein autografes Material greifbar ist, stützt sich die Neuausgabe auf den Leipziger Erstdruck von 1886.
Anlässlich einer Aufführung der Sonate im Jahr 1887 durch den Cellisten Julius Klengel bemerkte ein Kritiker, die meisten Werke v. Herzogenbergs [glichen] andächtigen Gebeten zu seinem künstlerischen Gotte, sprich: zu Johannes Brahms. Dies ist überspitzt formuliert, denn wiewohl Brahms Einfluss nicht zu überhören ist, spricht aus der Cellosonate op. 52 ein inspirierter, keineswegs nur devoter Komponist. Jeder der drei Sätze verrät künstlerische Individualität: Dem leidenschaftlich-drängenden und trotz großer Länge überaus stringent komponierten Kopfsatz folgen ein e-Moll-Adagio in ernst-elegischem Ton und eine zur Grundtonart a-Moll zurückkehrende Variationenfolge über ein schlichtes syllabisches Thema. Im Vergleich zu manch anderem spätromantischen Werk für diese Besetzung erweist sich der Cellopart als technisch nicht allzu schwierig, während für den vollgriffig gesetzten Klavierpart wie so oft gilt: Vorsicht, man soll das Cello nicht nur optisch wahrnehmen!
Fazit: Die Begegnung lohnt. In einer gewissenhaft erstellten Edition liegt hier ein Werk vor, das anderes verdient hat als seligen Dornröschenschlaf in staubigen Archiven.
Gerhard Anders