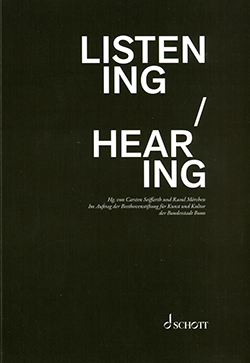Raoul Mörchen/Carsten Seiffarth (Hg.)
Listening/Hearing
Listening/Hearing: (aktives) Zuhören versus (passives) Hören. So griffig der Titel, so vielschichtig der Inhalt dieses anregenden Sammelbandes. Listening/Hearing markiert hier die Ränder des Themenfelds „Soundart“, ein ausgesprochen vielschichtiges Phänomen, dem man sich auf einer 2021 in Bonn durchgeführten Tagung von verschiedenen Seiten näherte. Vertreter:innen aus den Disziplinen Akustik, Musikästhetik, Medienwissenschaft, Physiologie, ja sogar Biologie kamen zu Wort, aber auch viele Klangkünstler:innen. Der Schwerpunkt lag allerdings auf der wissenschaftlichen Behandlung des Phänomens „Soundart“, womit in erster Linie Soundscapes und Klanginstallationen gemeint sind. Anlass der Tagung war der Abschluss des Projekts „Bonnhoeren“ der Beethovenstiftung Bonn. Von 2010 bis 2019 wurde pro Jahr ein Klangkünstler eingeladen, der oder die, ähnlich einem Stadtschreiber, in der Beethovenstadt arbeiten und das eigene Soundart-Projekt mehr oder weniger konkret auf die Stadt Bonn als Klangraum beziehen konnte.
Die Beiträge sind zu Themenkreisen geordnet: Zuhören/Hören, Geschichte des Hörens, Vorstellung und Erkenntnis, Hören durch Medien, Räume hören, Hören und Sehen, Welthören. Dokumentiert werden auch diverse Gesprächsrunden mit Soundartist:innen und Wissenschaftler:innen. Eine Fotodokumentation schließlich lässt das gemeinsame Konzert aller ehemaligen Bonner Stadtklangkünstler:innen im Rahmen dieser Tagung Revue passieren.
Ein paar Schlaglichter mögen das breite Themenspektrum illustrieren: Grundsätzliches steuert der Philosoph Gernot Böhme bei. Seine Ästhetik der „Atmosphäre“ liefert eine Art theoretischen Überbau der Soundart. Klänge respektive Sound, so Böhme, seien ein wichtiges Mittel, um eine Raumatmosphäre zu erzeugen. Zudem lenke Soundart das Hören auf sich selbst zurück, sie entinstrumentalisiere das Hören. Jens Papenburg bringt zeitphilosophische Überlegungen ein. Er stellt dem Hören einer „komponierten Erlebniszeit“, wie sie Musikwerken zugeschrieben wird, eine spezifische Art des Hörens gegenüber, wie sie für „Soundfile-Hören“, vorwiegend das Hören von Playlists, kennzeichnend ist. Letzterem fehle es an Zukunft, da alles, was man hören kann, bereits gespeichert sei.
In vielen Beiträgen wird für eine hochentwickelte Kultur des Hörens geworben, für ein aufmerksames, sensibles, ganzheitliches Hören. Umso überraschender, dass Jonathan Sterne ein Plädoyer für Schwerhörigkeit hält. Was zunächst irritiert, erhält – im Sinne einer Schutzfunktion – durchaus Plausibilität.
Wer über Soundart und Klangkunst nachdenken möchte, erhält mit diesem Band jede Menge Anregungen.
Mathias Nofze