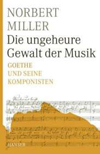Miller, Norbert
Die ungeheure Gewalt der Musik
Goethe und seine Komponisten
Wenn von Johann Wolfgang von Goethes Verhältnis zur Musik die Rede ist, dann fällt das Urteil über den Dichterfürsten meist kritisch aus, oft negativ. An seinen Kenntnissen auf diesem Feld werden starke Zweifel gehegt, die Genialität der Liedvertonungen Franz Schuberts nach seinen Versen habe er schlichtweg nicht erkannt, ebenso habe er infolge persönlicher Vorbehalte die Bedeutung Ludwig van Beethovens nicht entsprechend gewürdigt. Der ausgewiesene Goethe-Forscher Norbert Miller, Mitherausgeber der Münchner Ausgabe sämtlicher Werke Goethes, versucht nun wenn nicht eine Ehrenrettung, so doch einen weitaus differenzierteren Blick auf das Verhältnis des Dichters zur Musik. Miller bringt dazu neben seiner germanistischen Fachkenntnis ein profundes musikalisches Wissen mit.
Die ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zumeist geltende Meinung über Goethes musikalische Kompetenz bezeichnet Miller als philisterhafte Missbilligung, die dem Dichter mit dem Talent für die Musik auch jedes Urteilsvermögen absprach. Dass die Musik für Goethe eine weitaus größere Bedeutung hatte, als allgemein angenommen, unterstreicht schon der Titel von Millers sachkundigem und faktenreichem Werk, das mit Goethes Tod endet, die weitere Rezeptionsgeschichte also ausklammert.
Miller konzentriert sich auf die Komponisten, mit denen Goethe in einen intensiveren künstlerischen Austausch trat, die Begegnung mit dem jungen Felix Mendelssohn Bartholdy rückt den begnadeten Interpreten, weniger den Komponisten in den Mittelpunkt. Zur Zeit der Reise nach Italien ab 1786 war das Interesse des Dichters am Singspiel groß, er hatte gar mehrere Textvorlagen mit sich genommen. Dabei setzte er vor allem Hoffnung auf die Komponisten Philipp Christoph Kayser und Johann Friedrich Reichardt. Dass aus unterschiedlichen Gründen die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit keiner Überprüfung durch die Zeit standgehalten haben, deutet auf ein Grundproblem: Goethes Komponisten, so ausführlich und geradezu liebevoll sie von Miller behandelt werden, gehörten in keinem Fall zu den Größen ihrer Zeit.
Die Begegnung, ja sich entwickelnde Freundschaft mit Zelter, dem Begründer der Berliner Singakademie und Lehrer Mendelssohns, nimmt breiten Raum ein. Man spürt die Sympathie des Autors für Zelter, der heute zumeist als brav und bieder, gar mitverantwortlich durch seine Ratschläge für die ablehnende Haltung Goethes in Bezug auf die bedeutenden Musiker der heraufkommenden romantischen Zeit gemacht wird.
Miller breitet teilweise etwas detailverliebt, mit vielen Querverweisen Goethes Musikverständnis und seine gar nicht, wie so oft angenommen, begrenzten Kentnisse aus immerhin war Goethe als Intendant in Weimar auch für das Musiktheater zuständig. Doch je mehr Miller Fakten über Fakten türmt, um die These von der Begrenztheit des Goetheschen Verständnisses in Zweifel zu ziehen, desto deutlicher wird, dass viele der angesprochenen Vorurteile mehr als einen wahren Kern haben. Dennoch ist die materialreiche Arbeit Millers nicht zu unterschätzen, bringt sie doch mehr Klarheit in einen Bereich des Lebens und Werks von Goethe, der bislang eher oberflächlich abgehandelt wurde.
Walter Schneckenburger