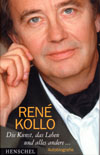Kollo, René
Die Kunst, das Leben und alles andere…
Autobiografie
Autobiografien können ungewollt verräterisch sein. Wenn René Kollo zur Feder greift, improvisiert er ein bisschen. Er tut das mit viel Offenheit, beschönigt nichts und gibt Fehler und Schwierigkeiten unumwunden zu. Der Sprache eher die Sprache einer Rede fehlt es zuweilen an Eleganz, da gibt es keine innere Rhythmik und die Wortwahl wirkt oft zufällig, aus dem Augenblick geboren. Das könnte charmant sein, aber gelegentlich ermüdet es auch.
Natürlich ist er vom Vater geprägt, dem bekannten Operettenkomponisten Willi Kollo, den er als einen eher aphoristischen Menschen bezeichnet, dessen Domäne die kleine Form gewesen sei. Er bescheinigt ihm aber auch etwas Leichtfertiges und Verspieltes, woraus er in Selbsterkenntnis folgert, dass der Apfel nicht allzu weit vom Stamm gefallen sei. Manche Bemerkungen zu seinem Lebensweg entbehren nicht der Komik, so wenn er schreibt: Ich laufe mittelgereift durchs Leben. Das ursprüngliche Berufsziel Schauspieler oder Kameramann entfiel. Dass er Opernsänger wurde, scheint reiner Zufall gewesen zu sein.
Große Hochachtung zeigt er gegenüber älteren Kollegen, was seine kritische Beurteilung des Nachwuchses und der Ausbildung erklärt. Die heutige Situation, da in den letzten 40 Jahren aus Kultursubventionen Unterhaltungssubventionen wurden, wird scharf angegriffen. Er spricht von leidenschaftloser Routinearbeit und sieht das Ende der Oper nahe. In vieler Hinsicht schließt er sich Oswald Spenglers Buch Der Untergang des Abendlandes an, dessen Wahrheiten er heute bereits als realisiert betrachtet.
Dass kein Komponist unserer Zeit eine große Rolle für einen Tenor geschrieben habe, soll nicht unwidersprochen bleiben. Man denke an Egks Peer Gynt (der Alte), an Brittens Peter Grimes (Titelpartie), Bergs Wozzeck (Tambourmajor), von Einems Dantons Tod (u. a. Robespierre und Desmoulins), Nonos Intolleranza (ein Flüchtling) oder an Henzes Il Re Cervo (König Leandro) und Der junge Lord (Titelpartie).
Mit Opernregisseuren von heute geht er hart ins Gericht und meint, dass bereits Felsenstein ein Irrtum gewesen sei. Karajan und Strehler sieht er als gleiche Typen, wobei er ersteren als Machiavelli mit der Seele eines Kindes charakterisiert. Hohes Lob gewährt er Chéreau, der seiner Meinung nach im Bayreuther Ring Bewegung, menschliche Beziehung und theatralische Momente, also richtiges Shake-
speare-Theater, inszeniert habe.
Stimmlich scheint René Kollo ungemein empfindlich gewesen zu sein, was zu vielerlei Schwierigkeiten führte etwa mit Wolfgang Wagner oder Solti, durch plötzliche Absagen bedingt. Mit Everding kam es zu Differenzen, weil er mit dessen Regiekonzept für Tristan und Isolde nicht übereinstimmt. Tatsächlich wurde gerade diese Inszenierung vielfach angegriffen. Aufführungen in der Originalsprache erteilt Kollo eine Absage und meint, das sei wohl schick, jedoch künstlerisch nicht vertretbar.
Über seine ein Dreivierteljahr währende Intendanz beim Berliner Metropoltheater berichtet er sachlich und ehrlich. Gegen Kritik wehrt er sich nicht; Chéreaus Urteil, er sei ein bisschen faul, akzeptiert Kollo, weil er Singen als spannungsgeladene Ruhe beschreibt. Beispielhaft war für ihn in dieser Hinsicht Fritz Wunderlichs Interpretation der Arie des Lenski in Eugen Onegin, der sich dreieinhalb Minuten nicht rührte, aber durch tiefe Ausdruckskraft erschütterte.
Ingrid Hermann