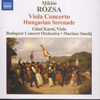Rózsa, Miklós
Viola Concerto/Hungarian Serenade
Film- und Konzertmusik betrachtet Miklós Rózsa (1907-1995) als gleichwertige Ausdrucksbereiche seines kompositorischen Schaffens. Er spricht sogar von seinem musikalischen Doppelleben, um hervorzuheben, dass er wie kaum ein anderer der Großen von Hollywood neben die Vertonung vorgegebener Sujets auch ganz eigenständige Stimmungsbilder zu setzen vermag. Die beiden neu eingespielten Werke repräsentieren dabei wichtige Eckpunkte seiner Orchestermusik, denn die 1946 abgeschlossene Hungarian Serenade op. 25 geht auf das gleichnamige, kleiner besetzte Opus 10 von 1932 zurück, während das Viola Concerto op. 37 von 1979 die Reihe seiner Orchesterwerke beschließt.
Auf ungebrochen spielfreudige Weise löst die relativ frühe Komposition ein, was sie mit den Satzüberschriften Marcia, Serenata, Scherzo, Notturno und Danza verspricht. Anhand eingängiger Melodien und ausschwingender Rhythmen entfalten sich effektvolle Spannungsbögen, die durch harmonische Schärfungen, klangfarbliche Finessen und elegante polyfone Verknüpfungen ein unverwechselbares Profil gewinnen. Die im Werktitel angekündigten folkloristischen Momente verschmilzt der in Budapest geborene Komponist kunstvoll mit seiner eigenen Klangsprache, sodass sie versteckt etwa hinter Synkopen, modalen Wendungen und einem mitunter sehr hoch geführten virtuosen Geigenpart zu entdecken sind.
Im Bratschenkonzert greift Miklós Rózsa im Grunde auf die gleichen Elemente zurück, zielt aber schon durch die ungewöhnliche Verwendung des viersätzigen Formmodells der Sinfonie auf anspruchsvollere, stärker aufeinander bezogene Aussagen. Demzufolge treffen nicht nur mit den Binnensätzen energiegeladene, trotzige Rhythmen und elegische kantable Linien aufeinander, sondern dieser vielfältig ausgeprägte, höchst differenziert gestaltete Kontrast entwickelt sich eindrücklich vom Themendualismus des Kopfsatzes bis zum rondoartigen Allegro con spirito des Finales. Die entscheidenden Impulse gehen hierbei zumeist vom brillant geführten Solopart aus, als ob der Komponist mit dem letzten seiner Konzerte an seine tiefe Vertrautheit mit der Viola und ihre Schlüsselrolle innerhalb seiner Vita erinnern wolle. (Mit diesem Instrument sowie der Violine hatte er bereits in früher Kindheit seine musikalische Ausbildung begonnen und bei der erfolgreichen Leipziger Uraufführung seines Streichtrios op. 1 im Jahre 1927 auch als Interpret seinen markanten kompositorischen Start begünstigt.)
Die von Mariusz Smolij geleiteten Budapester Musiker profilieren sich vorrangig innerhalb der größeren interpretatorischen Spielräume des Konzerts und entsprechen mit ihren gemäßigten Tempi, der bemerkenswerten Transparenz des Orchesterklangs sowie der Präzision selbst bei vertracktesten rhythmischen Passagen der vorherrschend expressiven Diktion dieses Spätwerks. Der einfühlsame Solist Gilad Karni besticht durch eine besonders sonore Tongebung und verleiht dem auch hier spürbaren Nationalkolorit überzeugende Authentizität.
Christoph Sramek