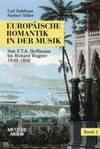Dahlhaus, Carl / Norbert Miller
Europäische Romantik in der Musik
Von E.T.A. Hoffmann zu Richard Wagner, 18001850, Bd. 2
Ein Jahrzehnt nach dem ersten ist auch der Folgeband der Europäischen Romantik erschienen, hat ein großes Projekt seinen Abschluss gefunden. Es geht auf Streitgespräche über Sprechende Musik der beiden Autoren zurück, die diese Anfang der 1970er Jahre führten und aus denen sich schließlich das Buchkonzept entwickelte: eine Folge von Essays zur Entwicklung von Oper und Sinfonie im Zeitalter der Romantik. Carl Dahlhaus, 1989 verstorbener Doyen der neueren Musikwissenschaft, hatte seine Beiträge bereits 1988 geschrieben und redigiert. Ko-Autor Norbert Miller führte die Publikation bewundernswert zu Ende, musste dabei zwar auf die geplanten Wechselreden der beiden Autoren verzichten, ließ aber das Erbe von Dahlhaus unangetastet.
Der im ersten Band vorgestellte Ansatz wird hier konsequent weitergeführt: Romantik nämlich als Gesamt-Epoche über achtzig Jahre zu betrachten, in deren Rahmen die gewöhnlich als Klassik titulierte Zeit als Präromantik subsummiert wird. In den Büchern drei und vier des zweiten Bandes behandeln Dahlhaus und Miller nun in einer Reihe von eigenständigen Beiträgen die Deutsche und europäische Romantik und widmen sich der Zukunftsmusik.
Die Einleitung gibt in einem monografisch ausgerichteten Kapitel über Johann Friedrich Reichardt einen Überblick über die Musikgeschichte Berlins ausgangs des 18. und eingangs des 19. Jahrhunderts. Und Berlin spielt auch im weiteren Verlauf des Buchs eine wichtige Rolle, etwa im Zusammenhang mit Gaspare Spontini oder Carl Maria von Weber. Immer wieder beleuchten tiefgründige musikästhetische Abschnitte Aspekte der als Romantik definierten Epoche, kommen daneben aber auch Analysen musikdramatischer, oft heute völlig vergessener Werke nicht zu kurz. Der Anspruch, die europäische Romantik zu beschreiben, darf ein wenig kritisch bewertet werden, denn natürlich spielen z.B. Frankreich oder Italien eine wichtige Rolle, doch andere Regionen rücken stark in den Hintergrund und dies in einer Zeit, die von Befreiungsbewegungen und der Ausprägung von Nationalstilen geprägt war. Dies mag mit der zeitlichen Begrenzung bis 1850 zu tun haben: Die gegenseitige Befruchtung von Oper und Symphonie, die Entwicklung zum Musikdrama (als Symphonischer Oper) und zur Symphonischen Dichtung ist vollzogen, der Höhepunkt der Romantik ist erreicht. Verständlich, wenn dann im hilfreichen Register eine Vielzahl von Komponisten zu fehlen scheinen, die gewöhnlich unter die Rubrik romantisch fallen.
Dies soll nur eine kleine Einschränkung sein ansonsten bleibt es ein wahrhaft lesenswertes und ob der Materialfülle überbordend reichhaltiges Buch. Die einzelnen Kapitel tragen keine direkten Autorenangabe; doch wer sich den Spaß machen will und auf die Lektüre der eher versteckten Editorischen Notiz verzichtet, in der die Zuordnung erfolgt, wird diese bald an den grundlegend unterschiedlichen Darstellungsformen erkennen können: dem knappen und wesentliche Grundaussagen skizzierenden Stil von Carl Dahlhaus steht der weiter ausholende, detailverliebte von Norbert Miller gegenüber.
Wolfgang Birtel